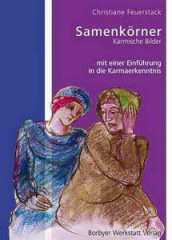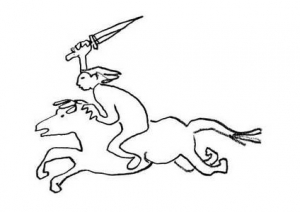Steppenmohn
Christiane Feuerstack
Samenkörner
karmische Bilder
mit einer Einführung in die Karmaerkenntnis
Steppenmohn
(Leseprobe)
I
„Ssabutai ist tot!“
Weit hallt der Ruf über das Schlachtfeld.
Er dringt bis an die Ohren Burukais, der immer noch verbissen gegen die Übermacht der feindlichen Horden ankämpft. Und wieder hört er: „Ssabutai ist tot!“
Erschrocken und ungläubig läßt Burukai sein Schwert sinken, wendet sein Pferd und hetzt es in wilder Verzweiflung in die Richtung, in der er seinen Vater zuletzt kämpfen sah. Niemals würde er das Schreckliche glauben können, bevor er es nicht mit eigenen Augen gesehen hatte!
Nein, es darf, es kann nicht sein! hämmert es in seinem Kopf, als er Ssabutai regungslos auf dem Boden liegen sieht. Er springt vom Pferd und beugt sich über den leblosen Körper seines Vaters. „Ssabutai!“ ruft er verzweifelt und packt ihn an der Schulter. „Ssabutai! Höre doch! Sprich! Ich bin da, dein Sohn!“ Dann strömen Tränen über das olivfarbene, vom Kampf gerötete Gesicht, und sein Körper wird von heftigem Schluchzen geschüttelt.
„Burukai! Bist du von Sinnen?“ hört er plötzlich eine aufgeregte Stimme hinter sich. „Beeile dich, wenn du nicht niedergemetzelt werden willst!“
Burukai blickt auf und sieht, daß Ssabutais Gefolge längst die Flucht ergriffen hat, und auch die Krieger der verbündeten Stämme sprengen in wilder Panik davon. Rasch springt Burukai auf sein Pferd und galoppiert den Freunden hinterher.
Eine riesige Staubwolke zieht sich über die Steppe bis zu den nördlichen Wäldern hin, in denen die Mongolen Schutz vor ihren Verfolgern suchen.
Fürs erste sieht es so aus, als hätten die Feinde die Verfolgung aufgegeben. Aber wer konnte wissen, was sie wirklich vorhatten? Heckten sie womöglich eine List aus, um die Mongolen wieder in eine Falle zu locken? Bestimmt war es sicherer, zunächst im dichten Wald Schutz zu suchen und das weitere Vorgehen zu beraten. Nach dieser verlustreichen Schlacht war die größte Vorsicht geboten.
„Burukai, du bist jetzt unser Häuptling! Was sollen wir tun?“ fragt Shungan, der Vertraute seines Vaters.
Bestürzt und verwirrt schaut Burukai in die Runde. Wohl hat Shungan Recht, daß Burukai der rechtmäßige Nachfolger Ssabutais ist, aber ist er den Aufgaben eines Häuptlings überhaupt gewachsen? So plötzlich, ohne Vorbereitung? „Als erstes sollten wir heute Nacht zum Schlachtfeld zurückkehren und unsere Toten bestatten“, sagt Burukai zögernd.
Die Blicke, die auf ihn gerichtet sind, machen ihn unsicher.
Schon wehrt Shungan diesen Vorschlag ab. „Das wäre zu gefährlich“, sagt er, und die anderen nicken schweigend.
„Laßt mir Zeit!“ bittet Burukai. „Wir sind jetzt alle zu erschöpft, um etwas Vernünftiges zu beschließen. Hier im Wald sind wir sicher und können uns ein paar Tage ausruhen.
![]()
II
Burukai liegt schon seit Stunden wach, obwohl er genauso erschöpft ist wie seine Freunde, die schon lange in tiefem Schlaf liegen. Immer wieder sieht er die erloschenen Augen Ssabutais vor sich, den leblosen Körper im Staub, die klaffenden Wunden. Sein geliebter Vater, einfach abgeschlachtet wie ein Stück Vieh!
Ja, er weiß es und hat es sich schon hundertmal gesagt, daß das eben die Gesetze der Steppe sind: Ein Mongole nimmt sich, was er braucht, notfalls mit Gewalt, und scheut dabei kein Blutvergießen. Ein Sohn der Steppe darf nicht zimperlich sein, hatte auch sein Vater immer gesagt. Das Schwache und Schlechte soll ausgerottet werden und das Starke und Gute übrigbleiben!
Bisher war auch Burukai von diesem Grundsatz überzeugt gewesen. Er hatte selbst nicht wenige Menschen auf dem Gewissen, gegen die sie zu Feld gezogen waren und die er für schlecht und unwürdig gehalten hatte. Mehr als einmal hatte er nach gewonnener Schlacht zufrieden und gutgelaunt über das Schlachtfeld geblickt und sich über die Scharen gefallener Feinde gefreut. Erfolg und Glück hatten diese Augenblicke für ihn bedeutet, und er hatte kein Unrecht dabei empfunden. Es war wie ein Spiel, bei dem es Gewinner und Verlierer gab.
Natürlich wußte Burukai, daß auch er einmal zu den Verlierern zählen könnte. Doch der Gedanke, daß diesmal sein eigener Vater so verstümmelt im Staub des Schlachtfeldes liegt, zur Freude seiner Feinde, raubt ihm fast die Besinnung.
Bilder aus seiner Kindheit tauchen vor ihm auf. Alles, was er mit seinem Vater erlebt hat, steht in diesem Augenblick vor seiner Seele:
Burukai war ein fröhliches Kind, voller Lebenslust und Tatendrang. Die Weite der Steppe war sein Königreich, Schafe, Rinder und Pferde seine Gefährten, das Zelt seines Vaters sein besonderer Stolz. Es war größer und bunter geschmückt als alle anderen Zelte im Ordu. An der Spitze ragte eine lange Stange empor, an der das Zeichen des Häuptlings befestigt war. Er mußte wohl neun oder zehn Jahre alt gewesen sein, als ihm zum ersten Mal seine Rolle innerhalb des Stammes bewußt wurde. Damals war ihm aufgefallen, daß die Erwachsenen ihn oft forschend anblickten und ihn mit größerem Respekt behandelten als seine Altersgenossen. Aber auch diese betrachteten ihn nicht als ihresgleichen. Oft hatte er sich fremd und ausgestoßen gefühlt. War es doch manches Mal geschehen, daß ihre Gespräche und ihr Gelächter verstummten, sobald er zu ihnen trat, und sie ihn dann verlegen und unsicher anschauten. War es deshalb, weil er ihr zukünftiger Häuptling sein würde? Drückte ihr Verhalten besondere Achtung aus oder genau das Gegenteil? Burukai wußte es nicht.
Als er vierzehn Jahre alt war, nahm sein Vater ihn eines Tages mit zu einem besonderen Platz weitab von den Zelten und Weideplätzen des Stammes. „Dies ist ein heiliger Ort“, sagte Ssabutai bedeutungsvoll. „Schon unsere Väter suchten diesen Ort auf, um sich das Wohlgefallen und die Unterstützung des Himmels für ihre Vorhaben zu sichern. Ich habe dich hierher geführt, weil du jetzt alt genug bist, um im Falle meines Todes meine Nachfolge antreten zu können.“
„Aber, Vater“, unterbrach ihn Burukai erschrocken. Doch Ssabutai besänftigte ihn: „Natürlich hoffe ich, noch lange zu leben. Doch sollst du beizeiten mit deinen zukünftigen Pflichten vertraut gemacht werden. Vor allem sollst du heute, für jetzt und alle Zeiten ein Gelöbnis ablegen, allen Mitgliedern unseres Stammes in Treue verbunden zu bleiben, sie nach besten Kräften zu unterstützen und zu fördern und dich für ihr Wohlergehen verantwortlich zu fühlen.“
![]()
III
Über zehn Jahre ist es her, daß Burukai dieses Gelöbnis abgelegt hat, und nur selten hat er seitdem daran gedacht. Jetzt kommt ihm schlagartig die ganze Tragweite seiner Verantwortung zum Bewußtsein. Konnte er seinem Volk gerecht werden? Würden sie ihm gehorchen? Was erwarteten sie überhaupt von einem Häuptling? Daß er sie zu weiteren Eroberungszügen führen würde, zu besseren Weideplätzen, größerem Besitz? Was waren seine eigenen Ziele?
Unruhig wälzt er sich auf seinem Lager hin und her. Bald würde der Morgen grauen, bald würden die Freunde in ihn dringen, um seine Entscheidungen zu hören, und er hat noch kein Auge zugetan und ist verzweifelter als je zuvor. Der Tod seines Vaters steht als übergroßes Schreckensbild vor seinen Augen. Und nicht nur das. Unzählige Gesichter sieht er vor sich, Feinde, die er sterben sah, die seine Hand getötet hatte, und die auch Söhne, Frauen und Brüder hatten. Ihre brechenden Augen starren ihn an wie eine stumme Anklage: Burukai, was hast du getan? Wie vielen unbekannten Menschen hast du ihr Liebstes genommen? Wieviel mehr Leid hast du verursacht, als dir je zugefügt wurde. Dein Vater ist auch nicht mehr wert als sie.
„Nein!“ stöhnt Burukai auf. „Geht weg, ihr Augen, ich kann euch nicht ertragen!“ Aber er weiß, daß sie bei ihm bleiben werden als ewige Mahnung, nie mehr einem Menschen das Leben zu nehmen.
Aber was würden die Freunde sagen, wenn er ab sofort jeden Kampf untersagte? Würden sie ihn nicht verspotten und Feigling nennen? Ja, er hört sie schon lachen über sein weiches Herz, das unfähig war, die Gesetze der Steppe zu ertragen. Nein! Diese Blöße konnte er sich nicht geben. Und so befiehlt er am nächsten Morgen, die Gefallenen zu rächen und den Feinden den Garaus zu machen. Auch die Häuptlinge der verbündeten Stämme ziehen mit. Aber der geplante Vergeltungsschlag verläuft wenig erfolgreich. Burukai kämpft nur zum Schein, ohne jemanden zu verwunden. Er hofft, daß die Freunde nichts merken.
Bis zum Einbruch der Dunkelheit wird gekämpft. Wiederum sind auf beiden Seiten große Verluste zu beklagen. Burukai hat genug. Es wäre Wahnsinn, jetzt weiterzumachen. Die Übermacht der feindlichen Horde ist nicht zu schlagen. Also beschließt er, mit dem verbliebenen Rest seines Stammes umzukehren. Einige der Verbündeten folgen seinem Beispiel, die anderen ziehen auf eigene Faust weiter.
In gedrückter Stimmung reitet die zusammengeschmolzene Truppe dem heimatlichen Ordu entgegen. Wie würden sie die Nachricht von Ssabutais Tod aufnehmen?
Schon haben Frauen und Kinder die Herannahenden erspäht und eilen ihnen entgegen. Unter ihnen ist Balaika, Burukais Frau, mit einem Säugling auf dem Arm. „Dein Vater kommt heim“, raunt sie dem Kind glücklich zu. „Wie er Augen machen wird, wenn er dich sieht!“ Doch als sie Burukai an der Spitze der Reiter sieht, erbleicht sie. Sie weiß, was das zu bedeuten hat. „Ssabutai?“ fragt sie ängstlich, als Burukai vor ihr vom Pferd springt.
„Ssabutai ist tot“, erwidert Burukai und schlägt die Augen nieder. Balaika schweigt beklommen. Dann zeigt sie auf das Kind und flüstert: „Dein Sohn.“
Burukai lächelt, küßt seine Frau und sein Kind und sagt leise: „Wir wollen ihn Talugi nennen. Er soll es einmal besser haben als ich. Ich werde dafür sorgen, daß wir in Frieden und ohne Kampf leben können.“
Balaika blickt ihn erstaunt an: „Er ist doch ein Sohn der Steppe, wie du.“
„Ja“, erwidert Burukai, „und wer sagt, daß es in der Steppe keinen Frieden geben kann?“
Balaika schweigt, aber sie sieht irgendwie erleichtert aus. Möge Burukai Recht behalten! denkt sie bei sich.
Burukai erklärt den Männern des Ordus, daß in der nächsten Zeit verlustreiche Eroberungsfeldzüge vermieden werden müssen, um das bestehende Stammgebiet sichern zu können. Niemand widerspricht, zumal in diesem Moment erschreckend viele Väter, Brüder und Söhne zu betrauern sind.
![]()
IV
Etliche Jahre sind so dahingegangen. Burukai hat seine Söhne und Töchter heranwachsen sehen, die Herden sind größer und fetter geworden, der Handel mit den Kaufleuten aus China blüht: Burukai könnte glücklich sein. Aber er bemerkt auch, daß viele seiner Männer unruhig und unzufrieden sind. Im Blut der Mongolen steckt Tatendrang und Eroberungslust, zumal die Weidegebiete für die gewachsenen Herden zu klein geworden sind.
„Höre, Burukai“, sagt Shungan eines Tages, „lange genug haben wir in Ruhe und Langeweile gelebt. Unser Volk hat sich vergrößert, neue junge Männer sind herangewachsen, das Land ist für uns und unsere Herden zu klein geworden.“
„Ich weiß, was du sagen willst“, fällt Burukai ihm ins Wort, „aber du kennst meine Meinung!“
„Ich weiß nur, daß du ein Feigling bist!“ schnaubt Shungan verächtlich. „Und das ist nicht nur meine Meinung!“ Damit entfernt er sich.
Burukai seufzt. Wie oft hat er schon versucht, seinen Männern zu erklären, warum er kein Blutvergießen mehr erleben will – vergeblich! Sie würden ihn wohl nie verstehen!
„Ein Mongole nimmt, was er braucht, auch wenn dabei Blut fließt!“ sagten sie dann immer.
Immer häufiger reitet er allein in die Steppe hinaus, nur um niemanden zu sehen und Ruhe zu haben. Unter dem weiten Himmel fühlt er sich geborgen. Die Natur kennt keinen Krieg.
Eines Tages kommt Munlik, ein junger Mann aus seinem Stamm, aufgeregt zu ihm. „Shungan, Waritai und Oelik schicken mich zu dir“, sagt er. „Sie behaupten, daß Sasskar mit seinen Leuten einen Teil unserer Herde gestohlen hat und verlangen von dir, sofort zu handeln und das Vieh zurück zu erbeuten!“
„Sasskar? Er ist unser Verbündeter und war während des großen Feldzugs ein treuer Freund. Ich kenne ihn, seit ich mit meinem Vater zu ihm ritt, um ihn für den gemeinsamen Eroberungszug zu gewinnen. Niemals würde er uns bestehlen!“
weiter gehts im Buch
![]()